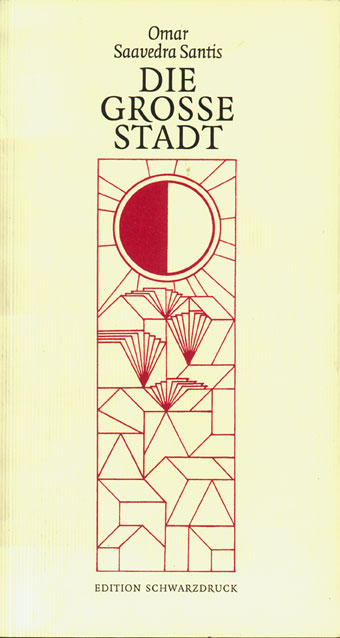Die große Stadt
Roman von Omar Saavedra Santis
Das Buch
Die Daten
Der Autor
Die Presse
Leseprobe
In dem Buch wird vordergründig der Versuch der Alphabetisierung eines ganzen Volkes durch eine gerade an die Macht gekommene Volksfrontregierung beschrieben. Und das Scheitern dieses Versuchs. Das Buch spielt eindeutig in Chile, ohne daß irgendjemand Allende heißt. Soweit die trockenen Fakten. Aber es ist ein lateinamerikanisches Buch, in dem alles drin ist: die Liebe und das Leben, Literatur und Gesellschaft, Witz und Tragik, Utopie und Realität … Das absolute Lieblingsbuch des Schwarzdruckers, welches Vergleiche mit den Romanen von Amado oder Marquez nicht zu scheuen braucht.
Aus dem Spanischen übersetzt von Leni Lopez • Mit einem Nachwort des Autors für diese Auflage und einem Nachwort von Christel Berger zum Autor sowie einem Glossar verwendeter Fremdwörter • Berlin 2002 • 12 x 22 cm • Paperback • 360 Seiten • ISBN 978-3-935194-09-9 • 20 Euro
Geboren am 15. Juli 1944 in Valparaiso. Saavedra Santis studierte Medizin, Schauspielkunst und Journalistik. Bis September 1973 war er Chefredakteur einer Tageszeitung. Nach dem Putsch 1973 wurde er politisch verfolgt und emigrierte 1974 in die DDR. Er verfasste Romane, Kurzprosa, Schauspiele. Diese erschienen in Deutschland, Chile, Costa Rica, Polen, Österreich, Japan und den USA. 1986 erhielt er den Anna-Seghers-Preis, danach noch viele andere Auszeichnungen. Heute lebt Saavedra Santis wieder in Chile.
Rezension aus dem FREITAG vom 19. 7. 2002 von Gert Eisenbürger
SPRECHENDE BÜCHER
Requiem auf eine Utopie
Der letzte Aufenthaltsort Erich Honeckers lenkte kurzfristig den Blick auf ein Kapitel DDR-Geschichte, das im Westen Deutschlands kaum bekannt war: das Exil von einigen Tausend Chilenen im Arbeiter- und Bauernstaat. Etwa 5.000 Flüchtlinge waren auf der Flucht vor der mordenden Soldateska Pinochets nach dem 11. September 1973 aus Chile nach Deutschland gekommen, 3.000 fanden Aufnahme in der BRD, gut 2.000 in der DDR. Das politische Profil der Exil-Chilenen war hüben wie drüben relativ ähnlich: es waren Leute aus allen Parteien der Linken, kritische Intellektuelle und Gewerkschafter. In beiden deutschen Staaten entstand nach 1973 chilenische Exilliteratur. In der alten BRD waren es Autoren wie Antonio Skármeta (heute Botschafter Chiles in Berlin!), Hernán Valdez, Carlos Lira, Christián Cortéz oder Pedro Holz, in der DDR Omar Saavedra Santis, Guillermo Deisler (gestorben 1995 in Halle), Carlos Cerda oder Roberto Ampuero, deren Prosa und sogar Lyrik übersetzt und gelesen wurde. Die künstlerisch interessantesten Repräsentanten des chilenischen Exils in der DDR waren sicherlich Guillermo Deisler mit seiner im Grenzbereich von Literatur und bildender Kunst angesiedelten visuellen Poesie und der Romancier Omar Saavedra Santis. Von letzterem sind in den Verlagen Neues Leben und Aufbau vier Romane und ein Band Erzählungen erschienen, der letzte hieß Frühling aus der Spieldose und erschien 1990, wenige Wochen vor dem Ende der DDR. Seitdem war es still geworden um diesen Autor, an dem der deutsche Literaturbetrieb bislang wenig Interesse zeigt. Kaum verständlich, wenn man Saaverda Santis´ Roman Die Große Stadt von 1986 liest, der kürzlich neu aufgelegt wurde. Denn hier präsentiert sich ein großer lateinamerikanischer Erzähler, der in kleinen Geschichten historische Prozesse transparent macht. Der Roman beginnt ganz beschaulich. Wir erleben das unaufgeregte Leben in der Großen Stadt; für Kenner Chiles unschwer als Saavedra Santis´ Heimatstadt Valparaíso zu erkennen. Dort betreibt der aus Nazideutschland geflohene Frederico Niemeyer zusammen mit seinem Angestellten Oliverio Sotomayor eine Leihbibliothek. Das geordnete Dasein hat ein Ende, als die Parteien der Linken die Wahl gewinnen. Einer der Kunden der Leihbibliothek, der eigentlich gegen jede anspruchsvolle Lektüre resistente Gewerkschafter Pancho Benavente, wird dazu verdonnert, das Amt des Ministers für Kunst und Kultur zu übernehmen. In dieser Eigenschaft lässt er Oliverio Sotomayor zu sich rufen und teilt ihm mit, dass er ihm das Amt des „Generaldirektors der Volksbibliotheken“ übertrage. Die Sache hat allerdings einige Haken: Weder existieren bislang Volksbibliotheken, noch gibt es einen Etat zum Ankauf von Literatur. Und wie Leute für Literatur begeistern, wenn das anvisierte Zielpublikum zu 80 Prozent aus Analphabeten besteht? Oliverio Sotomayor hat eine unglaubliche Idee: Wenn Menschen Bücher nicht lesen können, dann müssen sie sie eben hören. Gesagt, getan. Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen der Großen Stadt initiiert er das Projekt der sprechenden Bücher. Alle Teilnehmer müssen sich je ein Buch vornehmen und zum späteren Vortrag auswendig lernen. Natürlich werden das keine trockenen Wiedergaben, sondern engagierte Rezitationen. Die Jugendlichen identifizieren sich mit den Helden „ihrer“ Bücher. In ihren Vorträgen werden sie alle lebendig. Die Rezitatoren, die bald nur noch die „sprechenden Bücher“ heißen, treten auf Märkten, in Häfen, Fabriken, Agrarkooperativen und Gefängnissen auf. Die Literatur, ehedem nur etwas für die Elite, wird buchstäblich zum Tagesgespräch auf den Straßen und in den Kneipen. Alles die Erfindung eines phantasiebegabten Autors, der die Literatur liebt und an die Macht der Vorstellungskraft glaubt? Sicher. Aber nicht nur. Omar Saavedra Santis´ Roman Die große Stadt ist ein Buch über ein – aus heutiger Sicht – ungeheuerliches und verrücktes Projekt: den Versuch einer Bewegung von Sozialisten, Kommunisten, linken Christen und Radikalen, in Chile ohne Waffengewalt die politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen radikal umzugestalten. Das Ziel war eine sozialistische Demokratie, die Bewegung nannte sich Unidad Popular und ihre Symbolfigur war der Arzt Salvador Allende. Ungeheuerlich und verrückt war das Projekt, weil es in den traditionellen Machtgruppen Chiles und der Nixon-Administration in Washington entschlossene Feinde hatte, die alles daran setzten, das Experiment gründlich und definitiv zu zerstören. Die Feinde der Umgestaltung im Roman sind personifiziert im Geheimdienstoffizier Bruno Perthel. Ihm sind die sprechenden Bücher das größte Ärgernis, symbolisieren sie doch den kulturellen Aufbruch, der mehr als alles andere althergebrachte Normen und den Status Quo in Frage stellt. Dieser Griff nach den Sternen muss genauso zerstört werden wie der Angriff auf das Privateigentum. Mit der Parabel der sprechenden Bücher macht Omar Saavedra Santis die politische und kulturelle Aufbruchstimmung im Chile der Unidad Popular lebendig. Die Große Stadt ist der Roman einer Epoche und die Reflexion über die Kraft einer Utopie. Aber anders als die Figuren des Romans haben die Leser das historische Wissen über das, was am 11. September 1973 und danach in Chile geschah. Deshalb ist der Schrecken bei aller geschilderten Begeisterung von Beginn an gegenwärtig. So stellt sich gerade in den Passagen, in denen die Euphorie jener Tage spürbar wird, ein Gefühl der Trauer ein. Die Große Stadt ist in diesem Sinne auch ein Requiem. Ein Requiem, das die Hoffnung impliziert, dass noch nicht alles zu Ende ist. Erwähnenswert bei der Neuauflage im Berliner Kleinverlag „Edition Schwarzdruck“ sind die aufwendige und sehr ansprechende Typographie und Aufmachung und ein aktuelles Nachwort des Autors, das leider nicht so sorgfältig redigiert wurde wie der Rest des Buches.
Zweifellos war Herr B. derjenige, der am meisten darunter litt, daß die Menschlein der Großen Stadt eine Optik hatten, die so wenig dialektisch war, um den Lauf der Welt zu beobachten. Zwar gelang es Herrn B., die Straßenkomödianten mit seiner Verfremdungstheorie bis zur Hysterie zu begeistern, doch war er nicht imstande, sie davon zu überzeugen, daß Galilei es absolut ernst meinte, wenn er behauptete, daß das Denken das größte Vergnügen der menschlichen Rasse sei. »Sie verstehen Ihre Figuren nicht, Don B.«, widersprachen die Komödianten. »Verzeihen Sie, aber wie sind Sie nur daraufgekommen, daß das Denken größeren Spaß machen könnte, als zu vögeln oder mit Freunden ein Gläschen Wein zu trinken. Verzeihen Sie schon, aber da hat sich Galileo wohl einen Witz erlaubt.« Als ihm Federico, schamrot im Gesicht, diese epikureische Ansicht übersetzte, versank Herr B. in grüblerisches Schweigen. Lange an seiner Virginia ziehend, murmelte er so etwas wie, da müsse er sein »Kleines Organon« noch einmal überprüfen. Diese kleinen Differenzen in der gegenseitigen Wertschätzung halfen den Menschlein, zu entdecken, was sie mit den berühmten Ausländern verband und was sie von ihnen trennte, abgesehen von der Sprache und dem Essen. Selbst als alle darin übereingekommen waren, die materielle Existenz der Farben zuzugeben, erhob sich eine nicht enden wollende Diskussion um die Definition dessen, was weiß, und dessen, was nicht schwarz war. Auf einem Niveau, das eher verzwickt zu nennen war und auf dem weiß Gott nicht alle verstanden, was man sagte oder zu sagen wünschte, kamen im Verlauf eines Kolloquiums mit einheimischen und auswärtigen Dichtern über das Thema »Der Realismus in der Kunst und die Phantasie in der Realität« die Differenzen erneut zum Ausbruch. In seiner absoluten Eigenschaft als Hausherr gebot der Dichtervater dieser entflammten Kontroverse halb gelangweilt und mit näselnder Stimme Einhalt: »Der Dichter, der nicht realistisch ist, stirbt. Aber der Dichter, der nur realistisch ist, stirbt auch. Der Dichter, der nur irrational ist, wird nur von seinem eigenen Ich und seiner Geliebten verstanden, und das ist ziemlich trostlos. Der Dichter, der nur Rationalist ist, wird sogar von den Eseln verstanden, und auch das ist reichlich trostlos. Für solche Gleichungen gibt es keine Zahlen auf dem Reißbrett, es gibt keine von Gott oder dem Teufel vorgeschriebenen Zutaten; diese beiden hochwichtigen Persönlichkeiten führen in der Poesie nur einen unablässigen Kampf, und die Schlacht gewinnt mal der eine, mal der andere, aber die Poesie selbst darf nicht unterliegen.« Alle klatschten. Klar, es gab auch einige, die klatschten nur aus Höflichkeit und neigten den Kopf zu der Seite, wo der methodische Zweifel saß. Der Maler aus Málaga rief seinen Gegnern, sie unverhältnismäßig provozierend, zu: »Selbst um Realist zu sein, braucht es Talent!« (…)